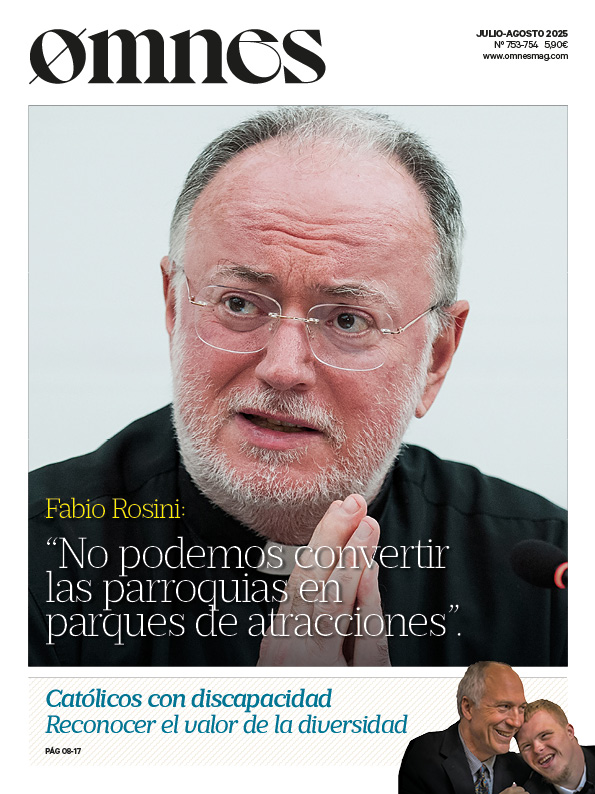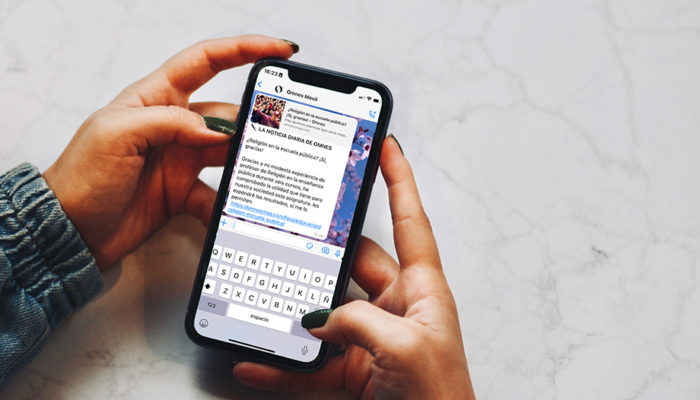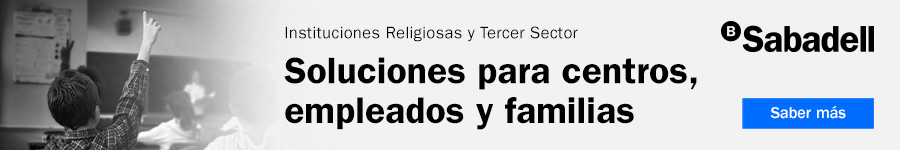Bei der Betrachtung der verschiedenen Skulpturen, Gemälde oder architektonischen Elemente in den verschiedenen Tempeln stößt man häufig auf Elemente biblischen Ursprungs, deren Bedeutung in direktem Zusammenhang mit der dargestellten Szene oder Figur steht und Teil einer Ikonographie ist, die die theologische Botschaft visuell vermittelt.
Einige sind besser bekannt, wie zum Beispiel das Bild des Lammes oder der Schlange, die von den Füßen des Königs zertreten wird. Jungfrau MariaEs gibt jedoch noch andere Elemente, die häufig in der volkstümlichen Ikonographie auftauchen und deren Bedeutung oder Bezug vielen Gläubigen unbekannt ist.
Lamm
Die Figur des Lammes ist ein biblisches Element, das sich auf Jesus bezieht. So wie im Alten Bund das Opfer des Lammes zur Sühne für die Sünden dargebracht wurde, so tilgt im Neuen Bund Jesus, das Lamm Gottes, durch seinen Tod die Sünden der Welt.
In der Erzählung aus Exodus 12 befreite das Blut des Lammes an den Türen der Häuser der Hebräer sie von der Plage der Ägypter; das Blut Christi, das in seinem Leiden und Sterben vergossen wurde, befreit die Menschen von der Sünde und reinigt sie: "Diese sind es, die aus der großen Trübsal kommen; sie haben ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes". (Offb 7:14).
Bereits Jeremia und Jesaja verwenden das Bild des Lammes, um auf den Messias hinzuweisen: "...".Ich wurde wie ein sanftmütiges Lamm zur Schlachtbank geführt". (Jer 11, 19) und "wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das zum Scherer geht". (Jes 53,7).
Die Figur des Lammes wird in der Apokalypse mit der Anwesenheit des apokalyptischen Lammes ihre größte Wirkung entfalten: "Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet; das hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt auf die ganze Erde". (Offb 5,6-7).
Die christliche Ikonographie hat diese beiden Bilder des Lammes übernommen: das eucharistische Lamm, das sanftmütig sein Blut für die Sünden der Welt vergießt, und das mächtige Lamm des letzten Buches, vor dem sich die Könige der Erde niederwerfen und das den teuflischen Drachen besiegt.
Der Stammbaum von Jesse, die Genealogie von Jesus
Der Stammbaum Isais bezieht sich auf die Genealogie Jesu, die im Neuen Testament in den Evangelien von Matthäus und Lukas ausführlich beschrieben wird. Die erste Genealogie zeichnet Jesu Abstammung von König David bis zu Joseph, seinem irdischen Vater, nach, und die zweite führt zurück zu Gott selbst.
Die Bedeutung der Genealogie war für das jüdische Volk von zentraler Bedeutung, da sie die Legitimität und Erfüllung der messianischen Prophezeiungen in Jesus begründete, wie Wissenschaftler betonen. Indem sie seine Verbindung zu den Schlüsselfiguren des Alten Testaments aufzeigt, unterstreicht sie, dass Jesus der lang erwartete Messias ist, der Israel versprochen wurde.
Eine der schönsten Darstellungen dieses Jesse-Baums findet sich auf dem Altarbild in der Kapelle Santa Ana der Kathedrale von Burgos, einem Werk von Gil de Siloe, dessen zentrales ikonografisches Thema die genealogische Herkunft der Jungfrau durch den Jesse-Baum darstellt.
Propheten, Könige und Priester
1997 widmete Johannes Paul II. eine seiner Audienzen dem Thema "Christus in der Geschichte der Menschheit, die ihm vorausging". Die Worte des polnischen Papstes sind ein praktischer Leitfaden, um in den Vorfahren Christi die wichtigsten Merkmale seiner messianischen Natur zu erkennen.
Der Pontifex nannte Abraham, Jakob, Mose und David, Figuren, die in den verschiedenen künstlerischen Darstellungen des Lebens Christi immer wieder auftauchen: Abrahams Freude über die Geburt Isaaks und seine Wiedergeburt nach dem Opfer war eine messianische Freude: Sie kündigte die endgültige Freude an, die der Erlöser bieten würde, und nahm sie vorweg. Mose als Befreier und, vor allem, David als König. Dies sind einige der Bilder, die in Gemälden und Skulpturen wiederkehren, die sich direkt auf Christus beziehen.
Einer der originellsten Querverweise ist die Figur der Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland und der Königin von Saba und Salomo. So wie die Weisen aus dem Morgenland sich auf den Weg machten, um dank ihres Wissens den Herrn anzubeten, besucht die Königin von Saba Salomo, um Zugang zur Weisheit des Sohnes Davids zu erhalten.
Diese Symbolik zeigt sich beispielsweise in der Triptychon der Anbetung der Heiligen Drei Königevon Bosch aus dem Jahr 1494, in dem die Szene mit der Königin von Saba im Mantel von Gaspar dargestellt ist.
Die Einbeziehung dieser Figuren als Nebenfiguren in Altarbilder oder in die Sockel sakramentaler Monstranzen war ein konstantes Merkmal des Barock, sowohl in Europa als auch in Lateinamerika, und schuf eine visuelle Kontinuitätslinie zwischen dem Alten und dem Neuen Testament.
Adams Schädel
In Darstellungen des gekreuzigten Christus erscheint sehr oft ein Schädel am Fuß des Kreuzes.
Einige berüchtigte Beispiele finden sich in Die Kreuzigung von Andrea Mantegna oder Giotto, Der Kalvarienberg von Luís Tristán, oder das prächtige Der gekreuzigte Christus Elfenbeinschnitzerei von Claudio Beissonat.
Das Vorhandensein dieses Schädels und einiger Knochen am Fuße des Kreuzes deutet darauf hin, dass der Überlieferung zufolge die Überreste Adams an derselben Stelle ruhen sollten, an der Jesus gekreuzigt wurde.
Auf diese Weise überwindet Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod Adams und zahlt das Lösegeld für die Seele des gefallenen Menschen. Nicht umsonst heißt die Kapelle unter dem Kalvarienberg in der Basilika des Heiligen Grabes so, Adams-Kapelle.
Diese Symbolik des Schädels Adams wird oft mit der baumartigen Darstellung des Kreuzes in Verbindung gebracht und verweist direkt auf das Holz, an das Jesus Christus genagelt wurde.
Vertreibung aus dem Paradies und dem Garten
Die Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies, von der im dritten Kapitel der Genesis berichtet wird, ist eines der konstanten Bilder in der christlichen Ikonographie. Sie erscheinen im Heilsgeheimnis in verschiedenen Stadien in Beziehung zueinander.
Eine der interessantesten Beziehungen ist die Einbeziehung von Adam und Eva in die Darstellung der Verkündigung an die Jungfrau, für die wir ein paradigmatisches Beispiel in Fra Angelicos feinem und detailliertem Werk zu diesem Thema haben. Der Ungehorsam Adams und Evas steht im Gegensatz zum absoluten Gehorsam der Jungfrau in ihrer "Es geschehe mir nach Wunsch".
Adam und Eva werden aus einem reinen Garten vertrieben, aus dem das Leben entsprang: der Garten, der den jungfräulichen Schoß Marias vorwegnimmt, in dem das Leben, das Christus ist, geboren wird und der auch im Hohelied anklingt: "Du bist ein eingezäunter Garten, meine Schwester, meine Frau; eine eingezäunte Quelle, ein versiegelter Brunnen".. Maria, die Pforte des Himmels, öffnet dem Menschen das Paradies wieder, indem sie den Erlöser zur Welt bringt.
Zertretene Schlange
Es ist eines der populärsten Bilder der marianischen Symbolik: der Fuß der Jungfrau, der eine Schlange / einen Drachen zertritt.
Das Bild hat seinen Ursprung in Genesis 3, 15: "Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen; sie wird dir den Kopf zertreten, wenn du sie auf die Ferse schlägst".
Dieses Bild ist besonders mit der Darstellung der unbefleckten Jungfrau Maria verbunden, da sie "die Frau" schlechthin ist.
Die Allegorie der Schlange unter dem Fuß der Jungfrau findet sich beispielsweise auf dem Bild, das die Colonna dell'Immacolata in Rom krönt, sowie auf den meisten bildlichen und skulpturalen Darstellungen der Unbefleckten Empfängnis.
Die Ricke
Die Hirschkuh ist eines der Tiere, die im Alten Testament vorkommen und eng mit dem Zustand der menschlichen Seele bei Gott verbunden sind.
"Wie die Hirschkuh nach Bächen sucht". (Ps 42,2) war dieser Psalm vor allem in den ersten Jahrhunderten des Christentums eine Inspiration als Bild für den christlichen Katechumenen, der sich auf den Empfang der Sakramente, des lebendigen Wassers, vorbereitet.
Das Bild der Hirschkuh auf Ornamenten und Kultgegenständen, insbesondere solchen, die mit der Eucharistie in Verbindung stehen, wie Kelche und Textilien, und sogar als Form für eucharistische Hostien, wie sie in Tunesien gefunden wurden und aus dem 6.