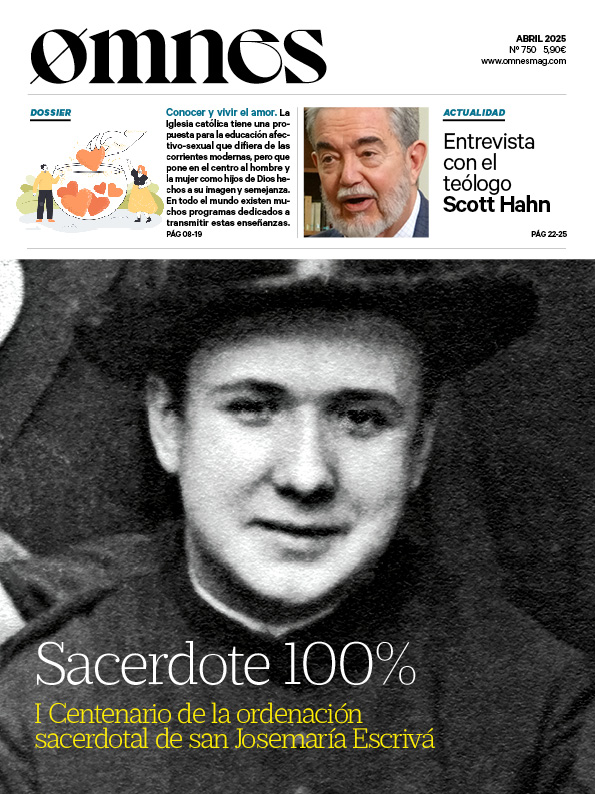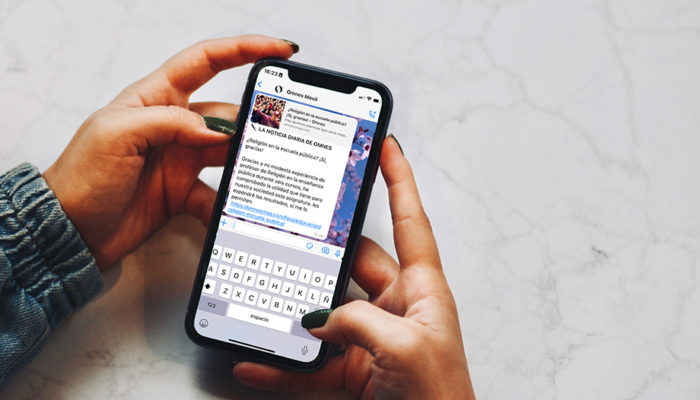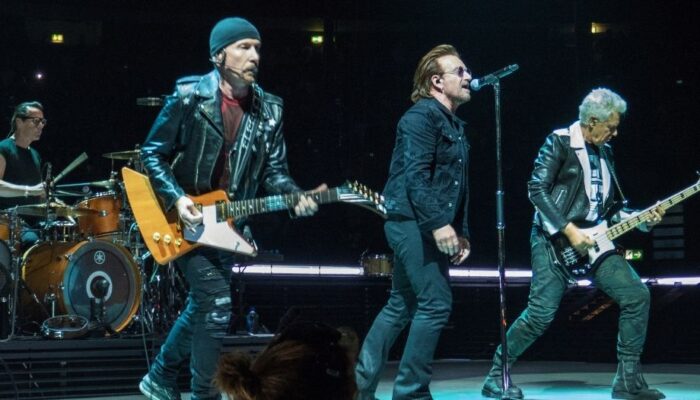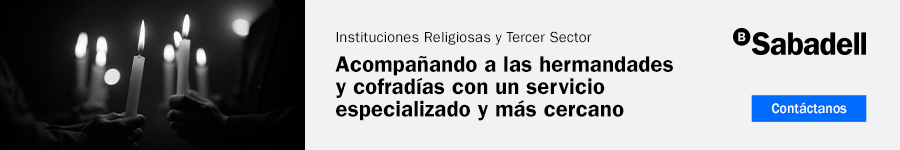Die Dämonenvon F.M. Dostojewski. Eine Reise in die moralische "Solidarität
Die Dämonenvon F.M. Dostojewski. Eine Reise in die moralische "Solidarität Barefoot", Hakunas Film über die Lebenskraft der Musik
Barefoot", Hakunas Film über die Lebenskraft der Musik "Kein Dialog mit dem Teufel" mahnt Papst beim Angelus
"Kein Dialog mit dem Teufel" mahnt Papst beim AngelusDer Film Nefarius (2023) der amerikanischen Filmemacher Chuck Konzelman und Cary Solomon zeigt mit bemerkenswertem Realismus ein intensives Gespräch zwischen einem Häftling in der Todeszelle, der von einem grausamen und intelligenten Dämon besessen ist, und dem Psychiater, der für seine Beurteilung im Gefängnis zuständig ist. Die erzählerische Spannung beruht fast ausschließlich auf dem Dialog zwischen den beiden Figuren, wodurch eine beunruhigende und zutiefst nachdenkliche Atmosphäre entsteht.
Der Film ist aus ökumenischer Sicht konzipiert, d. h. er vermeidet ausdrücklich jeden besonderen Bezug zum Katholizismus, wie z. B. die Fürsprache der Jungfrau Maria, die Heiligen, die Sakramente oder das Amtspriestertum. Der Kern der Botschaft ist jedoch zutiefst spirituell und dreht sich um das absolute Vertrauen in Gott, dessen Heilshandeln im Mittelpunkt steht. Dies zeigt sich schon in der Lehre Jesu Christi im Vaterunser: "Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen" (Mt 6,13).
Die Härte der Geschichte, die manchmal schwer zu ertragen ist, scheint auch darauf abzuzielen, ein ernsthaftes Nachdenken über die Abschaffung der Todesstrafe anzuregen. In diesem Sinne kann der Film als ein Plädoyer für das Leben gelesen werden, ganz im Sinne der von Papst Franziskus propagierten Änderung des Katechismus der katholischen Kirche.
Eine moderne Debatte über das Böse
Die Charakterisierung der Figuren und das Tempo der Sequenzen fesseln sofort die Aufmerksamkeit des Zuschauers, der in eine echte Debatte über Gut und Böse in der heutigen Welt eintaucht. Der Film entlarvt die Argumente der Postmoderne und konfrontiert den Zuschauer mit einer spirituellen Realität, die oft ignoriert oder lächerlich gemacht wird.
In diesem Rahmen entsteht ein großes Paradoxon: Der Dämon Nefarius arbeitet seit der Kindheit des Psychiaters daran, seine Seele zu beeinflussen, Atheismus zu säen und den Boden zu bereiten, damit er, wenn die Zeit gekommen ist, ein Todesurteil unterschreibt. Das Gespräch zwischen den beiden zeigt, wie die Leugnung des Spirituellen (die Existenz von Gott, des Teufels, der Seele) das wahre innere Drama des Menschen verbergen kann.
Konzelman und Solomon gelingt es mit bemerkenswertem Geschick zu vermitteln, wie es dem Psychiater gelingt, sich vor der Besessenheit zu retten, indem er wieder zum Glauben und zum Vertrauen auf Gott zurückfindet. Es ist genau diese Anrufung, die den Dämon daran hindert, in ihn einzudringen. So erscheint der Weg des Bösen als ein Prozess: Er beginnt mit Stolz und Egoismus, geht über das Misstrauen gegenüber Gott und gipfelt in seiner Verleugnung oder in der Anbetung eines falschen Bildes, das von Satan selbst entstellt wurde.
Der Film zeigt klar und deutlich, dass die Ablehnung Gottes zu einer radikalen Unfähigkeit führt, mit dem Problem des Bösen umzugehen, sowohl mit dem eigenen Leiden als auch mit dem Leiden der anderen. Und wenn man Gott leugnet, wird das Böse noch unverständlicher und hoffnungsloser. Es geht hier nicht darum, das Problem des Bösen zu lösen, sondern es zu entlarven. Für eine umfassendere Betrachtung dieser Frage siehe die jüngsten Arbeiten von José Antonio Ibáñez Langlois.
Das Geheimnis des Leidens und der menschlichen Freiheit
Es ist wichtig, zwischen zwei Arten des Bösen zu unterscheiden: dem physisch Bösen und dem moralisch Bösen. Was das erstere betrifft, so genügt es, sich daran zu erinnern, dass die Schöpfung ein natürliches System im Gleichgewicht ist, in dem bestimmte Prozesse mit Schmerzen oder Zerstörung verbunden, aber nicht sinnlos sind. Gott ist nicht der Urheber des Bösen, weder direkt noch indirekt. Er hat die Welt mit ihren Naturgesetzen erschaffen und ist immer gegenwärtig, um uns zu helfen, unseren Leiden einen transzendenten Sinn zu geben.
Was das moralische Übel - die Sünde - betrifft, so lässt Gott sie zu, weil er vor allem gewollt hat, dass der Mensch frei ist, fähig, das Gute zu wählen und daher zu lieben. Die Freiheit, so erinnerte der heilige Johannes Paul II. in Veritatis splendorist untrennbar mit der Wahrheit verbunden, die Christus selbst ist: "Weg, Wahrheit und Leben". Daher versteht der heilige Thomas die Freiheit als Kraft, der heilige Josefmaria als Energie und Edith Stein als den Mut der freien Seele.
Eine christliche Antwort auf das Leiden
Abschließend sei noch auf die klare Darstellung des Leidens durch den Heiligen Johannes Paul II. in Salvifici doloris. Angesichts der großen Frage, die sich nach dem Schrecken des Holocausts stellte - "Warum hat Gott das zugelassen? Benedikt XVI. Er schlug vor, die Überlegungen in ein Gebet umzuwandeln: "Warum, Herr, hast du das zugelassen? Und Johannes Paul II. gab eine christliche und hoffnungsvolle Antwort: Das Leiden kann zu einer Berufung werden, zu einer Teilnahme am erlösenden Kreuz Christi. Ein Geheimnis, das den Schmerz nicht auslöscht, sondern ihm einen ewigen Sinn gibt.
Weihbischof der Erzdiözese Santo Domingo, Dominikanische Republik